|
|
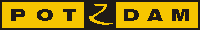
|
Sehnsucht
nach Heimweh
Frank
Abt inszeniert Peter Handkes Familienepos "Immer
noch Sturm" am Deutschen Theater
|
|
|
Von Astrid Mathis
|
|
Es gibt in der Geschichte über die Familie wenig
zu lachen. Die Erinnerung an die slowenische Familie
in Kärnten, die Mutter, die sich das Leben nahm,
dabei hatte sie einmal gesagt: "Seit ich lebe,
war ich noch nie traurig", scheint an der Konstruktion
von Wänden und Türen festgehalten, durch
die sich die Schauspieler winden. Bis sie eine Wand
nach der anderen wegtragen. Das Bühnenbild löst
sich auf, Schatten kommen. Was bleibt von der Erinnerung?
Auf
der Hinterbühne der Kammerspiele des Deutschen
Theaters verdichtet Frank Abt die Geschichte auch
räumlich, während der Zuschauer Einblicke
in die persönlichen Erfahrungen von Peter Handke
bekommt. "Ihr Vorfahren macht mir ganz schön
zu schaffen", lässt Handke sein Alter Ego
sagen. Marquardt Müller-Elmau ist der Alte, der
sich erinnert und dem Publikum die Toten nahe bringt.
Unter dem Apfelbaum, an einem Tisch, im Jaunfeld nahe
den Karawanken in Kärnten. Zweiter Weltkrieg,
Partisanenkampf, Sprachverbot. "Unsere schönen
Namen eingedeutscht" heißt es. "In
unserem Haus ist kein Platz für Tragödie",
sagt der Vater der Familie Siuz (Michael Gerber).
Dafür müsste man aktiv sein, aber das war
die Familie nie. Er schimpft über Ursula, die
Mannslose mit Regenwettergesicht (überzeugend:
Simone von Zglinicki). In der Lakonie liegt Komik.
Immer wieder. Die Familie streitet und lacht, man
wundert sich über Äpfel- und Birnenformen.
Aber da ist auch Ekel. "Ekel vor dem Morgen,
Ekel vor der Fremde, Ekel vor meiner ewigen Sehnsucht,
Sehnsucht nach Heimweh" hat Benjamin. Die drei
Brüder, so verschieden wie nur irgend möglich.
Der Schüchternste, Gregor (Thorsten Hierse),
wechselt mit der Schwester Ursula zu den Partisanen.
Valentin (Ole Lagerpusch) wirkt am freiesten, ein
Weiberheld, der sich in der Familie Raum und Distanz
schafft, die oft nicht da ist. Im Krieg ist er einer
von vielen, muss hinnehmen, dass die Brüder sterben.
Eben sagt er noch: "Ich will noch mal im Chor
singen" und Gregor stellt fest, dass sie sich
nie für etwas entschieden haben, da ist es vorbei,
da trägt auch er ein Stück Bühnenbild
weg. Die Todesnachricht lähmt nicht nur die Mutter
(stark: Katharina Matz), sie trifft auch das Publikum.
Diese Leere. Handkes Mutter Maria, die Mutter des
Ich-Erzählers (Judith Hofmann), sucht den Vater
ihres Kindes. Vergeblich. Diese Vergeblichkeit lässt
Frank Abt die Zuschauer spüren.
Premiere 29. April 2015.
|
|
|
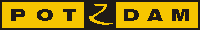
|
"Eine
gute Zeit wird kommen, aber wir haben sie noch nicht"
"Tabula
Rasa" im Deutschen Theater Berlin – nach Carl
Sternheim
|
|
|
Von Astrid Mathis
|
|
Die 100-Jahr-Feier der Kunstglasfabrik in Rodau steht
bevor. Es könnte alles so schön sein, aber
Carl Sternheims Held Wilhelm Ständer hat ein
Problem. Der Sozialdemokrat weiß nicht nur seine
Freizeit auszudehnen und im Schwimmbad zu nutzen,
er hat höheren Lohn eingestrichen und ist Aktionär
im Haus wie sein Kumpel Flocke. Damit ihm keiner von
der Leitung auf die Schliche kommt, holt er einen
radikalen Linken nach Rodau, der irritieren und Unruhe
stiften soll. Das macht Agitator Werner Sturm allerdings
zu gut. Dass die Belegschaft sich eine Arbeiterbibliothek
wünscht, will der gleich zur Revolution ausweiten.
Kurz entschlossen schickt Ständer Flockes Sohn
Artur hinterher, um Sturm im Zaum zu halten.
Carl Sternheims Komödie aus dem Jahr 1916 wurde
in Berlin uraufgeführt und nähert sich einer
Sackgasse der Gesellschaft in satirischer Manier,
zu der das Regie-Duo Tom Kühnel und Jürgen
Kuttner mit Spielzeiteröffnung eine Brücke
ins Jetzt schlägt: Abschied von der deutschen
Sozialdemokratie.
Schon
am Anfang wird klar, dass Wilhelm Ständer (Felix
Goeser) weit weg ist von proletarischer Pflichterfüllung
und sich selbst der Nächste. Seine Hausangestellte
Bertha (Judith Hofmann) bittet umsonst um "Aufbesserung"
ihres Lohns. In roter Badehose stürzt sich Ständer
ins Flachschwimmbecken und ackert sich zur Freude
des Publikums im Schmetterlingsstil mehrere Bahnen
durch. Auch sein Kumpel Heinrich Flocke (Michael Schweighöfer)
trägt rot, wie sich später zeigt. Doch die
beiden haben ihre eigene Definition von Klassenbewusstsein,
fürchten die Buchprüfung.
"Was
ist eigentlich links?" lässt das Regie-Duo
Tom Kühnel und Jürgen Kuttner Jörg
Pose fragen, der sich letztlich als Glasfabrikdirektor
entpuppt. Er stört vom Publikum aus und bekommt
mehr oder weniger kurze Antworten von der Bühne.
Bertha blüht geradezu auf, weil sie mal ihre
Meinung sagen kann. Ein anderer inszenierter Störfaktor
ist der Chor der Rodauer Glaswerke, der von "Auf,
auf zum Kampf" bis zum "Kleinen Trompeter"
und "Spree-Athen" alles singt, was als links
gilt. Er wird als Gewissen und Reminiszenz instrumentalisiert
und wirkt doch verloren zwischen den Drahtziehern.
Wie Werner Sturm (Christoph Francken) in speckiger
Lederjacke ist auch Flockes eifernder Sohn Artur (Daniel
Hoevels) mit Föhnfrisur und 80er-Jahre-Jeans
eine richtige Type in schönster Molière-Tradition.
In Ständers Nichte Isolde (Lisa Hrdina) sieht
der aufstrebende Journalist ein "Eizellchen",
kurz: "die perfekte Partnerin für ein harmonisches
Leben". Mit Isolde, Bertha und Nettelchen probt
er für das Fest - sehr zum Gefallen der DT-Zuschauer
- eine Nixen-Szene aus Wagners "Rheingold".
Im Laufe des Abends werden außerdem immer wieder
Szenen aus dem Klassiker "Wie der Stahl gehärtet
wurde" eingespielt. Gegen den oft anstrengenden,
da komplexen Sprachstil von Sternheim ein Muster an
Klarheit. Der Held verzichtet für die Revolution
auf die Liebe. "Eine gute Zeit wird kommen, aber
wir haben sie noch nicht." Ende.
Dann
schließlich, wie erwartet, der Auftritt von
Jürgen Kuttner, der zur Denkpause einlädt
und ordentlich gegen die Sozialdemokraten vom Leder
zieht. Für manchen Zuhörer sicher zu lang.
Kuttner zitiert Marthalers "Backen ohne Mehl"-Witz
als Metapher dafür, das den Linken abhanden gekommen
ist, was sie mal ausmachte. Das Eigentliche fehlt.
Oder anders gesagt: "Die Wahrheit kann an einem
anderen Ort gefunden werden, wo sie gebraucht wird."
Er kündigt noch das weichgespülte Black
Sabbath-Cover von Cindy & Bert "Der Hund
von Baskerville" an, über das sich das Publikum
herrlich amüsiert, und verschwindet wieder.
Das
Flachschwimmbad mit seinen kühlfarbigen Fliesen
und Erholungscharakter (Bühne: Jo Schramm) mutiert
am Ende zum Haifischbecken, die Treppen helfen nicht
beim Aufstieg, aber Ständer weiß: "Ein
Mensch kann in seinen Neigungen weit schweifen und
doch ein erstklassiger Genosse sein."
Premiere
am 11. September 2014.
|
|
|
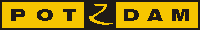
|
Michael
Jackson neu gestrichen
"American
Jesus Suite" in der Reihe "Across the Border"
im Konzerthaus Berlin mit dem "Quartett PLUS
1"
|
|
|
Von Astrid Mathis
|
|
So haben sie Michael Jackson noch nie gehört.
Als das Quartett PLUS 1 am 17. April im Konzerthaus
Berlin zur "American Jesus Suite" ansetzte,
ahnten die Gäste der Reihe "Across the border"
noch nicht, welch Vergnügen ihre Sinne in dieser
Dreiviertelstunde erfahren sollten. Quartett PLUS
1, das sind Katharina Pfänder, Kristina van de
Sand (beide: Violine), Kathrina Hülsmann (Viola)
und Lisa Stepf (Violoncello), dazu als Gast der Countertenor
Christopher Paskowski.
Ihre
Zuhörer an diesem Tag: Schüler ab 16 Jahre
von der 10. Klasse, Oberstufe bis hin zu berufsbildenden
Schulen aus Berlin, die von der Reihe "Across
the border" profitieren, die Gabriele Nellessen
ins Leben rief. Sie hat den Bereich Junior im Konzerthaus
Berlin aufgebaut. "Ich bin ständig auf der
Suche und bekomme viel Post mit Konzepten", erzählt
die Leiterin der Abteilung Junior. Seit 1987 ist die
Familien- und Jugendkonzertreihe im Haus ihr Ressort.
Einen Haufen verrückter Leute hatte sie dabei
und meint damit außergewöhnliche Künstler.
"Ich kenne Himmel und Menschen", beschreibt
Nellessen, wie gut sie vernetzt ist. 90 Prozent an
Anfragen werden verworfen, aber sie hört sich
durch und entwirft dann gemeinsam mit den Gästen
Programmunikate. "Im besten Fall entsteht, was
richtig passt", sagt sie geradeheraus.
Lebensweltbezug
für Schüler
80
Veranstaltungen sind für die Junioren in diesem
Jahr geplant. Drei davon zum Thema "Across the
border", was so viel heißt wie "über
Grenzen gehen, von klassischem Jazz über interkulturelle
zu Popmusik". Die erste Veranstaltung in der
Spielzeit war "I love Porgy", eine Zusammenarbeit
mit Greg Cohen vom Jazzinstitut Berlin und natürlich
mit Stücken aus George Gershwins Oper "Porgy
and Bess". Den Schülern Lebensweltbezug
bieten, um klassische Inhalte nahe zu bringen, darin
sehen Gabriele Nellessen und Konzertpädagogin
Christine Mellich ihre Aufgabe. Probenbesuche und
Führungen gibt es als Ergänzung. In dem
Projekt "Open your Ears", das künftig
Christine Mellich übernimmt, arbeiten Profimusiker
mit Schülern zusammen, inzwischen in der 4. Saison.
Jüngstes Beispiel ist das Zusammenwirken des
Fauré-Quartetts mit Profi-Tänzern von
Sasha Waltz und Schülern des Max-Dellbrück-Gymnasiums
Berlin zum Thema Abschied in der Neuen Musik.
Vor
dem Programm von "Across the border" gestalten
Studenten vom Lehrstuhl Musikpädagogik und -didaktik
der Universität Potsdam im Masterstudium Lehramt
Musik in den Klassen eine 90-minütige Werkeinführung.
Die künftigen Lehrer sollen ihre Praxiserfahrungen
erweitern und Partner wie das Konzerthaus Berlin nutzen
lernen. Die Zusammenarbeit beider Institutionen bietet
den Studenten die einmalige Gelegenheit, von der Integrationsschule
bis hin zum Musik Gymnasium die Konzertinhalte differenziert
zu vermitteln. Eine hohe Kunst", findet Jana
Buschmann, Lehrbeauftragte am Lehrstuhl von Frau Prof.
Dr. Birgit Jank.
Die
Nachbesprechung mit den Künstlern gibt es als
I-Punkt oben drauf. Hautnah können die Schüler
ihre Fragen stellen, sie als Menschen wahrnehmen.
Streicher
liegen lang
Das
Streichquartett "Quartett PLUS 1" kommt
aus der Klassik. Die Kostüme der Künstlerinnen
sind mit Gold und Schwarz ganz im Stile Michael Jacksons
gehalten, hier ein goldenes Schulterstück, da
ein halbes Jackett. Wie sie harmonisch ineinander
greifen, sich auch räumlich voneinander entfernen,
um dann in der Mitte auf dem Boden zu liegen, das
haut um. Die musikalischen Zitate von "Smooth
Criminal" über "We are the World"
bis hin zu "Scream" verschmelzen. Hier ein
Zupfen, da ein Umspielen. Stefan Wurz verarbeitete
das musikalische Material themengebunden in seiner
Komposition zu einer sechssätzigen Suite. Am
Ende sitzen die Streicherinnen bei "Four to the
cello" alle spielend an einem Cello, bis der
letzte geht. Das war schon lange ihr Herzenswunsch.
Die
Idee zu dem Programm kam ihnen, als sie 2011 für
die Ausstellung David LaChapelles in Hannover eine
Performance gestalten sollten. Einfach im Kreis sitzen
- das ist ihnen zu langweilig. So sind sie zu der
Reihe "Musik in Kunstwerken" gekommen, das
heißt: Alte Musik und Pop, Minimal Music inmitten
von Blumen-Stillleben ist eher ihr Ding. Oder besser
gesagt: ihre Kunst.
Seit
zehn Jahren arbeiten die Musikerinnen zusammen. Ihre
ersten Schritte unternahmen sie in Hildesheim/Niedersachsen,
wo sie im klassischen und theaterpädagogischen
Bereich ihre Ausbildung erfuhren. Über die Jahre
haben sie ausgetestet, was geht: Und, ja, sich beim
Musizieren auf den Rücken zu legen, ist gar nicht
so einfach, macht aber Spaß. Alles in allem
eine Abwechslung und Bereicherung zu Kulturwissenschaft,
Gesangsunterricht, Theaterpädagogik oder musikalischer
Früherziehung. Stilistisch sind sie nicht festgelegt,
jede bringt ihre Einflüsse ein. Ziel ist es,
die Jahrhunderte alte Formation des Streichquartetts
fremden Räume und Medien auszusetzen. Dafür
wurden "Quartett PLUS 1" 2013 mit der Nominierung
zum Yeah Award belohnt. An dem Projekt "Relax
your mind" war auch Countertenor Christopher
Paskowski mit einem Barockstück beteiligt.
"Um
so schön zusammen zu spielen, muss man Konflikte
lösen. Man führt eine Ehe zu viert",
gibt Katharina Pfänder abschließend zu.
|
|
|
© POTZDAM 2015
|
|